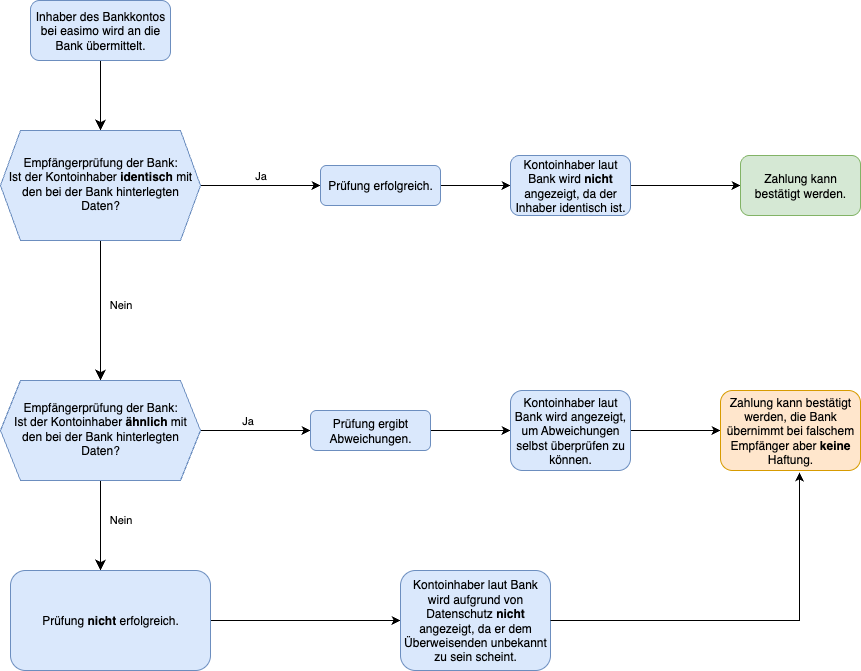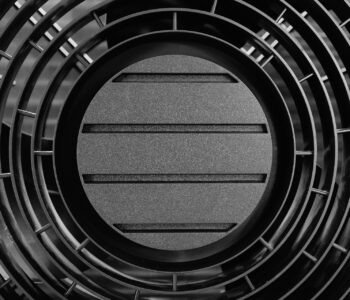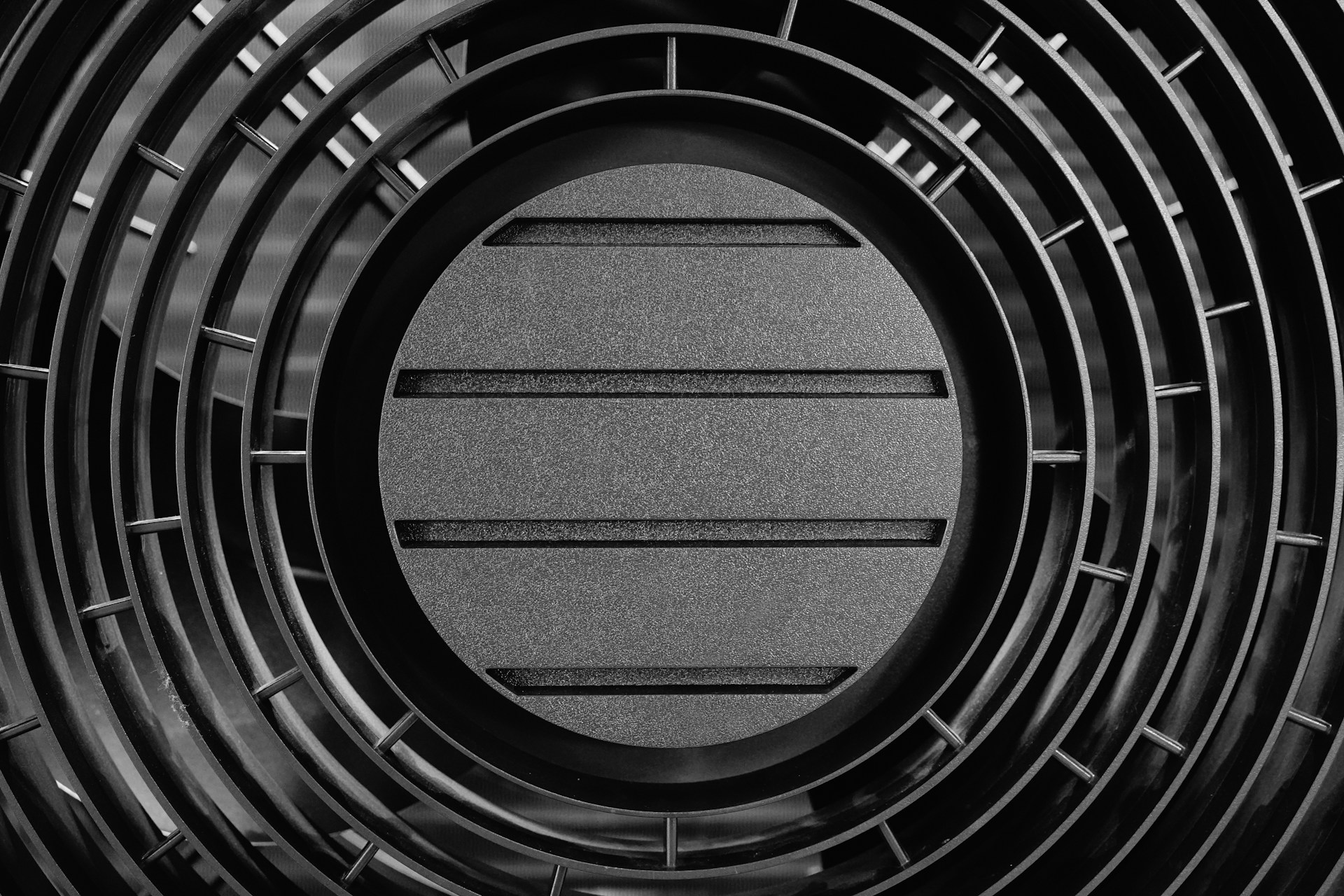Allgemein
Allgemein Der Wohnberechtigungsschein
Der Wohnberechtigungsschein

Wenn nach einer neuen Mietwohnung gesucht wird, gibt es bei den meisten Portalen eine Vielzahl an Filtermöglichkeiten, um die passende Wohnung zu finden.
Die meisten sind selbsterklärend- so kann nach der Quadratmeterzahl, den Kosten, der Lage oder auch nach Extras wie dem Vorhandensein von Garagen oder Balkonen gefiltert werden.
Mitunter kann auch explizit nach Wohnungen gesucht werden, welche einen Wohnberechtigungsschein erfordern.
Und was es damit auf sich hat, schauen wir uns in diesem Artikel näher an.
Wozu wird der Wohnberechtigungsschein benötigt?
Im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus wird Wohnraum geschaffen, welcher in erster Linie für bestimmte soziale Gruppen zur Verfügung gestellt werden soll, welche im herkömmlichen Wohnungsmarkt benachteiligt sind.
Dazu gehören unter anderem Personen mit geringem Einkommen, Alleinerziehende, Senioren, Menschen mit Behinderung oder auch Studierende oder Auszubildende.
Auch Personen, welche bereits anderweitig Sozialleistungen beziehen, können dazu zählen.
Der Staat fördert den Bau und teilweise auch die Instandsetzung dieser Wohnungen.
Im Gegenzug für die Förderung aus staatlichen Mitteln dürfen diese Wohnungen nur an die Personengruppen vermietet werden, für welche sie ursprünglich vorgesehen waren.
Der Wohnberechtigungsschein, oder kurz WBS, ist eine amtliche Bescheinigung.
Er bestätigt, dass der Besitzer des Scheins dazu berechtigt ist, eine solche durch öffentliche Mittel geförderte Wohnung zu beziehen.
Muss in jedem Fall ein Wohnberechtigungsschein vorliegen?
Die Einschränkung in der Vermietung unterliegt einer Bindungsfrist- das heißt, dass sie nach Ablauf dieser Frist auch auf dem freien Wohnungsmarkt vermietet werden kann, unabhängig vom Vorhandensein eines Wohnberechtigungsscheins.
Wie lange diese Frist andauert, hängt vom Bundesland und auch von der jeweiligen Förderung ab. Sie wird bei Bewilligung der Förderung festgelegt und beläuft sich in der Regel auf mehrere Jahre bis Jahrzehnte.
In speziellen Fällen kann der Vermieter einer sozial geförderten Wohnung bei den Behörden eine Befreiung vom Wohnberechtigungsschein beantragen. Hier wird dann im Einzelfall entschieden.
Der Grund kann etwa sein, dass die Personengruppe, für welche die Wohnung ursprünglich gefördert wurde, keinen ausreichenden Bedarf (mehr) hat und die Wohnung daher leer stehen würde, wenn sie nicht an andere Interessenten vermietet werden kann.
Wird eine Wohnung, welche nur für Besitzer eines WBS vorgesehen ist, ohne Erlaubnis an andere Personen vermietet, können hohe Geldstrafen für den Vermieter verhängt werden.
Wo und wie wird der Wohnberechtigungsschein beantragt?
Der WBS wird bei der kommunalen Behörde beantragt und ist ein Jahr lang gültig. Wird mit dem WBS eine Mietwohnung bezogen, dann bleibt er so lange gültig, wie dieses Mietverhältnis besteht. Andernfalls muss nach Ablauf der Gültigkeit ein neuer WBS beantragt werden, wenn weiterhin nach einer Wohnung gesucht wird.
Außerdem ist der WBS nur für jeweils eine Wohnung gültig. Wurde bereits eine Wohnung mit einem WBS gemietet, so muss ein neuer WBS beantragt werden, wenn der Mieter nun eine andere sozial geförderte Wohnung beziehen möchte.
Die Regelungen zum WBS sind von Bundesland zu Bundesland verschieden.
Grundsätzlich wird ein WBS nicht für eine einzelne Person, sondern für einen Haushalt ausgestellt. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine Familie, aber auch um eine Wohngemeinschaft handeln.
Geprüft wird vor allem das Einkommen des Haushalts. Dieses darf eine vom jeweiligen Bundesland festgesetzte Grenze nicht überschreiten.
Die Kommune, bei welcher der WBS beantragt wird, fordert entsprechende Nachweise- etwa in Form von Verdienstbescheinigungen, Einkommensnachweisen oder Rentenbescheiden.
In bestimmten Fällen werden auch andere Nachweise wie Bescheide der Pflegekasse über einen vorhandenen Pflegegrad oder ein Schwerbehindertenausweis angefordert.
Da die Einkommensgrenzen und andere Anforderungen von den Bundesländern festgelegt werden, berechtigt ein WBS immer nur zum Bezug von sozial geförderten Wohnungen in dem Bundesland, in welchem er ausgestellt wurde.
Bei einem Umzug in ein anderes Bundesland muss die Behörde dort prüfen, ob die Voraussetzungen für die Beantragung eines WBS mit den dortigen Regelungen weiterhin erfüllt werden.
Fazit
- Der Wohnberechtigungsschein (WBS) wird bei der Kommunalverwaltung beantragt.
- Er berechtigt zum Bezug von sozial geförderten Wohnungen.
- Für die Ausstellung dürfen die im jeweiligen Bundesland geltenden Einkommensgrenzen des Haushalts nicht überschritten werden.
- Der WBS erstreckt sich auf das jeweilige Bundesland und muss beim Umzug in ein anderes Bundesland erneut beantragt werden.
- Wird eine sozial geförderte Wohnung an Mieter ohne WBS vermietet, drohen dem Vermieter hohe Geldstrafen.